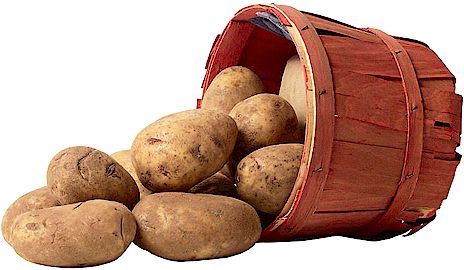
Deutschland klopft sich auf die Schulter. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise seien hier kaum spürbar. Im Gegenteil: die Wirtschaft melde Konjunktur und neue Arbeitsplätze. Kanzlerin Merkel behauptet sogar, Deutschland stünde „so gut wie lange nicht“ da. Während in anderen Ländern soziale Kämpfe aufbrachen, gilt die BRD als Hort des sozialen Friedens. Dabei zeigen sich selbst konservativste Medienvertreter entzückt über die deutschen „Arbeitnehmer“ und Gewerkschaften, die das „kleine Wirtschaftswunder“ durch ihre Zurückhaltung möglich machten. Auf der anderen Seite fragen sich Akteure der sozialen Bewegungen, von radikalen Linken bis zur Gewerkschaftslinken, wie diese Friedhofsruhe eigentlich sein kann. Immerhin hatten nicht wenige von ihnen zu Beginn der Krise auch hierzulande Ausbrüche von sozialen Kämpfen erwartet, z.T. sogar erhofft.
Von großem Interesse dürfte deshalb sein, wie die Situation in diesen Kreisen analysiert wird. Immerhin könnte davon abhängen, ob die hiesigen sozialen Bewegungen doch noch Mittel und Wege finden, Widerstand zu entwickeln. Neben zahlreichen Artikeln und Diskussionsveranstaltungen, die es bereits zu dem Thema gab, dürfte der Kongress „Wo bleibt mein Aufschwung?“ in Stuttgart aufschlussreich sein, der im Juli, organisiert von ver.di und dem Bündnis „Wir zahlen nicht für eure Krise!“, abgehalten wurde. Die Veranstalter hatten dafür „Referenten von sozialen Bewegungen wie ATTAC und aus dem linkskeynesianischen, gewerkschaftlichen Spektrum“ eingeladen.
Zu gut – zu schlecht?
Die dortigen Erklärungsmuster mögen sinnbildlich für die Debatte um den Krisenprotest in Deutschland sein. Auf der einen Seite wird darauf verwiesen – so etwa vom Stuttgarter ver.di-Chef Bernd Riexinger –, dass Deutschland aufgrund seiner Exportorientierung bisher von der Krise profitiert habe. Das Argument wurde bereits in vielen Beiträgen herangezogen, um ein mangelndes Krisenbewusstsein zu erklären. Allerdings wird es konterkariert durch die Tatsache, dass die große Masse in Deutschland durchaus massive Verschlechterungen hinnehmen musste, aber auch dadurch, dass Unmut und Krisenbewusstsein durchaus vorhanden sind (siehe unten). Dass es den Deutschen „noch zu gut geht“, wie an empörten Stammtischen häufiger zu hören, kann also kaum ein plausibler Erklärungsfaktor sein.
Auf der anderen Seite wird dann doch die soziale Verschärfung in Deutschland angeführt, hier dann allerdings unter dem Gesichtspunkt „verschlechterter Rahmenbedingungen“ für Bewegung. So verweist etwa Michael Schlecht, Chefvolkswirt der Linksfraktion im Bundestag, auf die allgemeine Prekarisierung, welche die Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaften unterminiert habe. Auch dieses Argument scheint irreführend. Zum einen handelt sich um keine deutsche Besonderheit: Prekarisierungsprozesse haben die Gewerkschaften weltweit vor neue Probleme gestellt. Zum anderen blendet es aus, dass der DGB selbst teilweise aktiv – z.B. mit Dumping-Tarifen in der Leiharbeit – an der Prekarisierung mitgewirkt, ihr zumindest aber keinen nennenswerten Widerstand entgegen gesetzt hat. Man kann anführen, dass hierzulande mit der Agenda 2010 krisentypische Maßnahmen vorweggenommen wurden, während in der Krise selbst solche Maßnahmen als potenzielle Auslöser von Massenmobilisierungen ausblieben.
Doch das Problem scheint tiefer zu liegen, wie ein vergleichender Blick nach Frankreich zeigt: Immerhin gab es dort bereits 1995 mit dem sog. Juppé-Plan den Versuch massiver Sozialeinschnitte, die zumindest teilweise abgewehrt werden konnten. Auch in anderen zentralen Auseinandersetzungen, etwa um die Rentenreform, nimmt sich der DGB – im Vergleich mit den französischen Gewerkschaften – fast schon tot aus. Richtig ist also vielmehr: Die Prekarisierung ist eine Folge der gewerkschaftlichen Schwäche – und nicht etwa umgekehrt.
Verwunderlich mag ebenso Riexingers Bekundung klingen, man wolle sich „mit den gewerkschaftlichen Umbrüchen der letzten Jahrzehnte auseinandersetzen, die eine offensive Interessenvertretung erschweren.“ Denn im Konzept des DGB war, seiner sozialpartnerschaftlichen Doktrin entsprechend, niemals auch nur eine „offensive“ Praxis vorgesehen. Und der jetzige Zustand des DGB ist nicht etwa die Folge von „gewerkschaftlichen Umbrüchen“, sondern eben einer kapitalistischen Offensive, während der der DGB selbst zu gar keinem Umbruch in der Lage war.
Gewerkschaft auf deutsch
Das Konzept des DGB hat eine lange Tradition. Auch wenn diese verschiedene politische Kontexte erfuhr, zieht sie sich wie ein roter Faden durch die Geschichte und bestimmt das Bild der Gewerkschaftsbewegung wie in keinem anderen Land: Von der Nationalisierung der Gewerkschaften und der Burgfriedenspolitik im Ersten Weltkrieg, über die Arbeitsgemeinschaften in der Weimarer Republik und den Versuch, eine „nationale Einheitsgewerkschaft“ herzustellen, bis zur modernen Sozialpartnerschaft und den neuerlichen Vorstößen zur Einschränkung des Streikrechts. Zentrale Kennzeichen der deutschen Gewerkschaftsbewegung waren schon immer ein hoher Zentralisierungsgrad und eine reduktionistische Arbeitsweise, wie sie kaum woanders auftrat. Dabei sollte sich insbesondere die sozialdemokratische Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerkschaft als weichenstellend erweisen. Aus ihr leiten sich sowohl die Reduktion der gewerkschaftlichen Aufgaben auf die Tarifpolitik im Rahmen des bestehenden Reglements ebenso wie der apolitische Charakter der deutschen Gewerkschaften ab, die auch nach der Distanzierung von der SPD fortbestanden. Die Abwesenheit politischer Streiks in Deutschland resultiert auch aus dieser Selbstbeschränkung, und zugleich wirkt das Modell generell dämpfend auf Konfliktdynamiken.
Dass selbst neoliberale Institutionen wie die OECD schon länger Gefallen an der deutschen Einheitsgewerkschaft gefunden haben, wurde in dieser Zeitung schon mehrfach erwähnt. Und sie meinen damit explizit das Modell und nicht etwa die Politik derselben, die sie weitestgehend durch Ersteres determiniert sehen. Das Modell garantiere Lohnzurückhaltung, eine geringes Streikaufkommen und somit lukrative Investitionsmöglichkeiten für das Kapital. Da wird Herrschaftswissen schon so unverblümt offen gelegt – und es wird dennoch ignoriert: Eine Diskussion, welche Bedeutung die deutschen Gewerkschaftsstrukturen für das hiesige Potential an Ungehorsam haben, findet kaum statt. Vielmehr wird die sozialdisziplinierende Funktion des deutschen Gewerkschaftsmodells weiter ausgeblendet und am Ideal der Einheitsgewerkschaft festgehalten – unter Missachtung zahlreicher Studien und der offensichtlichen Tatsache, dass andere Gewerkschaftsstrukturen eine viel größere Vitalität aufweisen.
Die Auswirkungen dieses Modells reichen weiter, als es erscheinen mag. Denn die Sozialdisziplinierung funktioniert nicht nur über die institutionelle Kanalisierung von Konflikten, sondern auch durch die Internalisierung passiver Mentalitäten, sowohl in den Gewerkschaftsspitzen als auch an der Basis. Darauf verweisen sogar die OECD-Studien. Schon vor über 200-Jahren bemerkte niemand geringeres als Adam Smith, dass Regimes der Arbeitsteilung bestimmte Typen von ArbeiterInnen hervorbringen, und zwar „so dumm und ignorant, wie ein menschliches Wesen nur sein kann.“ Man kann, ja muss diesen Gedanken auch auf die Gewerkschaften übertragen. Denn insbesondere der DGB ist ein integraler Bestandteil der militärisch angehauchten Arbeitsorganisation in Deutschland. Sowohl das Stellvertretungsprinzip als auch das reduktionistische Gewerkschaftskonzept sozialisieren ArbeiterInnen, denen es fremd ist, sich direkt zu wehren oder gar gewerkschaftliche Mittel für gesellschaftspolitische Veränderung ins Feld zu führen. Ökonomie, und dazu zählen auch die Gewerkschaften, ist eben auch ein sozialer Raum. Die darin gelebten Praxen wirken sich nachhaltig auf Bewusstsein und Kultur aus. Insofern die Hegemonie des DGB und damit dessen sozialisierende Macht ungebrochen ist, muss es nicht wundern, wenn die Beschäftigten hierzulande eher „jammern“ (BZ) als eine kämpferische Kultur zu entwickeln.
Autoritäre Perspektiven
Dieser „autoritäre Charakter“ sollte nicht unterschätzt werden. Eine Studie des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung München (ISF) kam zuletzt zu dem Ergebnis, dass das Krisenbewusstsein unter den deutschen Beschäftigten durchaus vorhanden sei. Demnach gebe es eine zunehmende Einsicht, dass dahinter „nicht nur eine personale Herrschaft, sondern die kapitalistische Ökonomie insgesamt steht“. Die Krise wird dabei vielfach nur „als Brennglas“ eines ohnehin fehlerhaften Wirtschaftsmodells begriffen. Obwohl die soziale Verschärfung tatsächlich zu einem starken Anstieg von Unmut geführt hat, wie auch eine Studie des Instituts Arbeit und Qualifikation der Uni Duisburg-Essen (IAQ) feststellt, sei die Situation geprägt durch eine „tiefe Ohnmachtserfahrung“. Die Wut fände keinen konkreten Adressaten, da man die „Schuldigen“ nicht im eigenen Betrieb verorte, sondern im Gesellschaftssystem insgesamt. Die Perspektive werde so auf „Staat und Politik“ verschoben, was zu „ausgeprägten Widerstands- und Protestphantasien“ führt, nicht aber zu wirklicher Gegenwehr.
Man muss in der hier erkennbaren Kapitalismuskritik nicht gleich auch eine Zunahme von Klassenbewusstsein erblicken. Denn dieses würde sicherlich eine betriebliche Handlungsperspektive mit einschließen und die „Betriebsgemeinschaft“ in Frage stellen. Kapitalismuskritik allein muss auch nicht progressiv sein. Denn bleibt die Betriebs- oder gar nationale Gemeinschaft intakt, und wird der soziale Konflikt nicht ausgetragen, verengt sich der Blick auf die „verantwortlichen“ staatlichen Autoritäten. Tatsächlich stellt denn auch das ISF eine „Reaktivierung von Sichtweisen dichotomen Gesellschaftsbewusstseins“ fest: „wir hier unten und die dort oben“.
Es wäre ignorant, keinen Zusammenhang zwischen dieser Mentalität und dem vorherrschenden Gewerkschaftsmodell zu sehen, das nicht gerade mit lodernden Streikwellen in Verbindung gebracht wird. Ohne konkrete Kämpfe entstehen einfach kein Selbstbewusstsein und keine Erfahrungen (erfolgreichen) kollektiven Widerstands. Dabei macht sich auch das zentralistische und arbeitsteilige Konzept des DGB bemerkbar, das die Politik als Vermittlerin in sozialen Fragen betrachtet und nicht vorsieht, soziale Verbesserungen auf sozioökonomischem Gebiet autonom zu durchzusetzen. Offenbar und leider wird diese Untertanen- und Ohnmachtsperspektive auch in der Gewerkschaftslinken selbst reproduziert. Das legen zumindest entsprechende Lösungsvorschläge nahe. So fordert etwa Schlecht: „Wir müssen als Gewerkschaften viel stärker den politischen Kampf dafür führen, diese Verschlechterungen zurückzudrehen, damit wir in der Tarifpolitik überhaupt wieder Luft zum Atmen bekommen.“ Und Riexinger führt an, dass eine weitergehende gesellschaftspolitische Auseinandersetzung nur durch Politisierung im Betrieb möglich sei. Auch wolle man „aus den Erfahrungen der Protestbewegungen Südeuropas lernen – um dann vielleicht auch in Deutschland bald mal wieder größere Aktionen auf die Beine zu stellen“, wie es Daniel Behruzi zusammenfasst.
Dass es vielleicht weniger diese Politisierungsbemühungen sind, als vielmehr die sozialen Strukturen und Praxen, die das Potential von Krisenprotesten ausmachen, ist hier, wie in der gesamten deutschen Linken, kein Thema. Als ob es lediglich um die richtigen Positionen ginge, die man transportieren müsse – ganz egal, über welche Struktur. Es scheint kaum reflektiert zu werden, dass der DGB noch nicht einmal dem Tagesgeschäft einer trade union nachkommt und dass in der Abstinenz kämpferischer Alltagspraxen womöglich auch die für die Proteste hinderliche Gehorsamskultur begründet liegen könnte. Statt auf diesem Gebiet Konsequenzen zu ziehen, vollführt man politische Ausweichbewegungen, die nichts an dem Grundproblem ändern, dieses womöglich sogar verfestigen. Das könnte sich später böse rächen. Denn wenn auch in Deutschland der Krisenunmut überhandnimmt, könnte sich dieser in Lösungswegen ergießen, die ganz der vorherrschenden Mentalität entsprechen.
